Über Schillers Jugendliebe, Schwalbennester und Saurier im Südzipfel Thüringens
von Stefanie Kießling
Sie ließe sich kaum besser erfinden, so wechselreich und manchmal phantastisch mutet sie an. Sie spielt weitab von den Kulturleuchttürmen Weimar, Erfurt und Jena, über den Dächern des kleinen Ortes Bedheim, ganz im Süden Thüringens. Sie erzählt von Glanz und Niedergang, von Zerstörung und Wiederaufbau, von Kulturfrevel und kreativem Idealismus. Sie — das ist die Geschichte des Schlosses Bedheim, der Kilian-Kirche und einer faszinierenden Familie.
Zugegeben, Bedheim liegt etwas abseits: Durch Wiesen, Felder, sanfte Hügel und Wälder schlängeln sich die Landstraßen, die von Hildburghausen und Bad Königshofen Richtung Bedheim führen. Und dann liegt es da, ländlich idyllisch an die Ausläufer der Gleichberge geschmiegt, bekrönt von Schloss und Kirche. Doch wer einmal den Weg dorthin – hinauf zu Schloss und Kirche – gefunden hat, den lässt das faszinierende Ensemble und seine Geschichte nicht wieder los.
Die Schlossbewohner: von Familienclans, Prinzen und Dichterlieben
Vor über 800 Jahren, 1169, erwähnten die Urkunden den Ort und das Schloss als Adelssitz des Runoldus von Bedheim. Die von Bedheims waren die ersten Besitzer des Gutes, bis es um 1400 in Besitz derer von der Kere gelangte. Nur wenige Jahrzehnte später, 1439, erbte Diez von Heßberg Bedheim, und bis in das 18. Jahrhundert hinein blieb das Schloss im Besitz dieser Familie. Im Jahr 1774 übernahm Prinz Joseph von Sachsen-Hildburghausen das Gut und baute es zu einer Sommerresidenz um. Doch schon 1778 verkaufte er es wieder an den Sächsisch-Hildburghausener Geheimrat und Regierungspräsidenten Conrad Friedlieb Rühle von Lilienstern – den Vorfahr der heutigen Eigentümer.
Über 200 Jahre lang ist nun die Geschichte des Schlosses mit dieser Familie verbunden, und sie mutet so spannend an wie ein Roman. Die von Liliensterns – 1743 in Frankfurt von Kaiser Karl VII. in den Adelsstand erhoben – haben so manche Berühmtheit in ihren Reihen. Da gibt es August Franz, der 1788 jene Frau nach Bedheim führte, für die der 24-jährige Friedrich Schiller 1783 umsonst und hoffnungslos schwärmte: Charlotte von Wolzogen. Charlotte starb bereits 1794, gerade 28 Jahre alt und liegt in der Kirche St. Kilian begraben. Prominenz erlangte auch Otto August (1780–1847) – als General, Militärschriftsteller, Kartograph, Numismatiker und nicht zuletzt als Prinzenerzieher am Weimarer Hof und Freund des Dichters Heinrich von Kleist. Doch Otto Augusts Heimat war nicht Schloss Bedheim: Seine Wurzeln reichten ebenfalls nach Frankfurt, doch sein Vater hatte ein Gut in Königsberg in der Prignitz (bei Wittstock) gekauft, und genau da wuchs er auf.
Ein ganz besondere Tierliebe: Hugo Rühle von Lilienstern
Zurück zu den Bedheimern: 1934 zog ein ganz besonderer Lilienstern in den Nebengebäuden des Schlosses ein. Er war circa drei Meter hoch und sieben Meter lang, hatte kurze Arme, einen langen Hals und wog etwa 130 bis 150 Kilogramm. Sein Name: Liliensternus liliensterni. Der Schlossherr, Landarzt und Paläontologe Hugo Rühle von Lilienstern hatte diesen Saurier 1932 am Gleichberg gefunden, ihm und seinen Verwandten einen Stall gebaut und seine Funde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sein „Saurierstall“ gilt als bedeutendste paläontologische Privatsammlung Europas. Heute ist sie leider nur noch Teil einer traurigen Geschichte: Hugo Rühle von Lilienstern starb 1946 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, 1969 erhielt seine Witwe Marie die Ausreisegenehmigung in den Westen. Sie durfte nach Frankfurt zu ihrem Sohn ziehen. Doch der Preis war hoch: die Sammlung von Hugo Rühle von Lilienstern zog um, von Bedheim ins Museum für Naturkunde Berlin.
Eine dunkle Gräfin und der Verdienstorden: Helga Rühle von Lilienstern
In jungen Jahren half sie mit ihrem Zeichentalent ihrem Onkel Hugo bei der Aufnahme seiner Saurierfunde. Nach dem Krieg kümmerte sie sich um die Inventarisierung des Hildburghäuser Stadtmuseums. Sie verließ 1958 die Heimat gen Westen, kehrte nach der Wende aber wieder zurück und widmete ihr Leben einer besonders geheimnisvollen Frau, die gerade wieder in den Medien für Furore sorgt: der Dunkelgräfin von Hildburghausen. Zahlreiche Publikationen, Vorträge und Tagungen legen Zeugnis ihrer Arbeit ab. Für Ihr Lebenswerk wurde Helga Rühle von Lilienstern 2011 mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
Was machen Schlossherren des 21. Jahrhunderts?
Sie stecken voll Energie, Erfindungsgeist, Durchsetzungkraft und Gelassenheit – denn anders lässt sich eine solche Lebensaufgabe nicht meistern. Seit 1993 wohnen wieder Mitglieder der Familie auf dem Schloss. Und von Jahr zu Jahr bringen sie das gesamte Anwesen stärker zum Leuchten. Florian Kirfel-Rühle ist Architekt mit Büro in Weimar und Dozent an der Bauhaus Universität Weimar. Und er scheint seinen Beruf mit seiner Berufung ideal zu verbinden: So kann der Schlossherr die Restaurierung des Schlosses selbst planen oder – zum beiderseitigen Nutzen – mit Bauwerkstätten Studenten für wichtige Arbeiten am Objekt begeistern. Damit so ein Schloss aber wiederauferstehen kann, braucht es mehr als nur ein Standbein. Darum betreibt die Familie eine eigene Gärtnerei und produziert Obst, Gemüse, Marmelade und Säfte in bester Bio-Qualität. Außerdem gibt es eine Behindertenwerkstatt, ein Gästehaus und ein Gartencafe. Und all die Arbeit wird nun langsam belohnt: im Mai 2012 hat der Bund Schloss Bedheim in das Denkmalschutz-Sonderprogramm III aufgenommen. Damit verbunden ist eine kleine finanzielle Hilfe, aber auch – und das ist den Eigentümern wichtig – die amtliche Anerkennung der überregionalen, vielleicht sogar nationalen Bedeutung des Schlosses. Doch ausruhen werden sie sich auf diesen Lorbeeren nicht, sie suchen weiter nach Förderern, Geldgebern und ehrenamtlichen Helfern. Denn so ein Schloss ist höchst anspruchsvoll.
Geschichten vom Bau: Moden, Frevel, Herzblut
Was sich dem Besucher heute als dreiflügelige Schlossanlage präsentiert, war in seinen mittelalterlichen Ursprüngen wahrscheinlich ein sogenanntes Weiherhaus. Jedoch überstand die alte Burganlage die Zeit der Bauernkriege nicht. Auf den Wiederaufbau als Renaissanceschloss folgte nur kurze Zeit später die nächste Katastrophe: Der Dreißigjährige Krieg hinterließ schwere Verwüstungen, Ort und Schloss verwahrlosten. Philipp von Heßberg war es dann, der 1736 mit dem Ausbau des Schlosses zu einer dreiflügeligen Anlage begann. Das große herrschaftliche Treppenhaus ließ Prinz Joseph Ende des 18. Jahrhunderts einbauen. Die Landwirtschaft wurde 1915 verkauft, was sich später als Glück herausstellen sollte: denn so entging das Schloss nach 1945 der Enteignung. Nach Marie Rühle von Liliensterns Auszug 1969 lagen die Geschicke des Schlosses in fremden, nicht besonders glücklichen Händen. In den 1970er Jahren wurde in den alten Mauern eine Schule untergebracht. Und weil die Räume eines Schlosses für eine solche Nutzung nicht wirklich geeignet waren, wurden sie kurzerhand angepasst – was im Weg war, wurde abgeschlagen, wo Platz gebraucht wurde, zog man Mauern ein. Auch Teile des Gartens mussten einem Sportplatz weichen. Ein trauriges Schicksal, das Schloss Bedheim mit vielen anderen historischen Bauwerken teilt.
Doch es geht noch schlimmer: Die falsche und rücksichtslose Nutzung eines Gebäudes ist frevelhaft, aber gar keine Nutzung ist katastrophal. Leider widerfuhr Schloss Bedheim genau das ab 1980. Die Schule zog aus und Meister Verfall ein. Das Portal am Westflügel stürzte 1988 zusammen, dem Ostturm drohte das gleiche Schicksal, so manchem Giebel fehlte das Dach. Die 1991 begonnenen Notsicherungen retteten das Schloss vor dem endgültigen Verfall. Und 20 Jahre später kann selbst der Laie sehen, was sich hier getan hat. Nur kurz das für Besucher schmackhafteste Beispiel: 1994 rettete ein neues Dach das Wachhäuschen im Garten, 2007 wurde es zu einem Cafe umgebaut, und zu was für einem: das Ambiente, der Kaffee, die Kuchen und die Herzlichkeit sind jede Anreise wert!
Ein besonderes Schmuckstück – die Kirche St. Kilian
Ebenso alt wie das Schloss ist die Kirche St. Kilian. Die Schlossherren waren lange Zeit zugleich die Kirchenpatrone. Bis ins 19. Jahrhundert war die Kirche darum mit dem Schloss über einen Patronatsgang verbunden. Ursprünglich als Wehrkirche errichtet, wurde St. Kilian im 17. Jahrhundert zu einer Barockkirche umgebaut. Glanzstück dieser Kirche und wohl weltweit einzigartig ist die Doppelorgel: 1711 erbaute Caspar Schippel die Hauptorgel, 10 Jahre später stiftete Hans Philipp von Heßberg eine zweite, die sogenannte „Schwalbennestorgel“. Ihr Erbauer Nikolaus Seeber baute außerdem die Hauptorgel so um, dass sich von ihrem Spieltisch aus beide Orgeln gleichzeitig bedienen lassen. Und das ist in der Tat eine technische Meisterleistung, denn zwischen beiden Orgeln liegen viele viele Meter. Nach ihrer Restaurierung 1996 ertönt nun ihr typischer Barockklang wieder – sehr zur Freude vieler Orgelliebhaber, die während des Thüringer Orgelsommers gerne und zahlreich zu den Konzerten nach Bedheim kommen.
Längst ist die Geschichte von Bedheim nicht auserzählt. Es gäbe noch viel zu berichten. Welche Geheimnisse schlummern in den Kellern der alten Scheune? Warum hängen Stethoskope an den Wänden und was hat es mit den zwei Toren im Garten auf sich? Wer Antworten auf diese Fragen sucht und sich von der gesamten Anlage, der Aussicht, den Hofprodukten und nicht zuletzt vom köstlichen Kuchen begeistern lassen will, muss hinfahren.
Weitere Informationen zum Schloss, der Kirche und der Schlossgärtnerei gibt es auf der Homepage von Schloss Bedheim. Dort stehen auch Hinweise zu den Öffnungszeiten des Hofladens, des Gartencafes und die Termine der Orgelkonzerte und anderer Veranstaltungen.
Zum Weiterlesen:
Bernhard Kirfel: Geschichten von Schloss Bedheim – do must dir wos eilass fall –. Schloss Verlag Bedheim 2008, Bd. 3, 12 € , zu beziehen beim Autor in 98630 Bedheim Schloss 1, oder über das Schloss Café (geöffnet Sa/So von 13–19 Uhr)
Zur Autorin: Stefanie Kießling, Lektorin und wissenschaftliche Koordinatorin, ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft Kulturerbe Thüringen e.V.









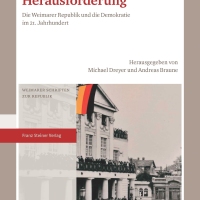




Aug 06, 2013 @ 00:30:36
Wir waren heute zu Gast auf Schloß Bedheim und bezaubert und fasziniert von der Atmosphäre des Ortes und der Umgebung. Wir durften den Maler Gerhard Renner kennenlernen und haben uns in seine „beiden Emailkannen“ verliebt – leider „fast am unverkiäuflichsten „!
Vielen Dank und viel Erfolg beim weiteren Erhalt und Aufbau des Schlosses.
Ingrid und Robert Matthes