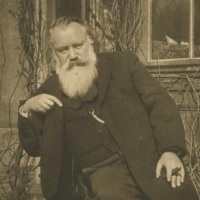Ein Kompendium über die womöglich fruchtbarste Zeit der Philosophie in Deutschland überhaupt
von Florian Scherübl
Die Philosophie des Deutschen Idealismus ist untrennbar mit den Namen einiger traditionsreicher Universitäten verbunden, die als geistige Zentren nach dem Verblassen des Glanzes der Aufklärung das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert erleuchteten. Neben Tübingen und Berlin war gerade das in Thüringen gelegene Jena einer der ausstrahlungsstärksten Koordinaten dieser Bewegung auf der philosophischen Landkarte des klassischen Jahrhunderts. Hier wirkte Fichte in den 1790er Jahren während des „Atheismus-Streits“, wenige Jahre später wurde der erst 23-jährige F.J. Schelling auf Geheiß Goethes hierher zum Professor berufen, Hegels Laufbahn als Philosophieprofessor begann an der heute nach Friedrich Schiller benannten Universität.
Neubegehung der nachaufklärerischen Philosophie
Walter Jaeschke und Andreas Arndt – beide renommierte Forscher zur Philosophiegeschichte der Aufklärung und des Idealismus in Deutschland – haben ein gut 800-seitiges Buch vorgelegt, in dem sie das von ihnen bereits ein halbes Leben lang vermessene Feld noch einmal neu abgehen: Die klassische deutsche Philosophie nach Kant. Um nichts weniger ist es den Autoren zu tun, wie aus dem Untertitel hervorgeht, als die damals aufgestellten Systeme der reinen Vernunft und ihre Kritik, die von ihren jeweiligen Verfassern untereinander angebracht wurde, darzulegen. Jaeschke, Professor emeritus für Philosophie in Bochum dürfte spätestens seit seinem Hegel-Handbuch zu den Größen der deutschen Hegel-Forschung zählen. Rasch ist es zu einem der Standardwerke des Forschungs-Zweigs avanciert, welcher sich des neben Kant bis heute wohl einflussreichsten Systemphilosophen überhaupt annimmt. Andreas Arndt, Professor für Philosophie an der Theologischen Fakultät der HU Berlin, ist seit Jahren Herausgeber des Hegel-Jahrbuchs und der Hegel-Forschungen; daneben betreut er die Gesamtausgabe der Werke Friedrich Schleiermachers.
Die Wissenschaft in der nachklassischen Epoche
Jaeschke und Arndt nehmen einen Zeitraum von 60 Jahren in den Blick. Sie beginnen 1785 : Die endgültigen Fassungen der drei Kantischen Kritiken lagen bereits vor und wurden eifrig rezipiert. Der Rahmen der Betrachtung reicht dann bis fast zur Jahrhundertmitte, 1845 – ein Zeitpunkt, zu dem Hegel, für Marx der Urheber der Weltphilosophie seiner Epoche, bereits seit 13 Jahren tot war, Schellings Spätphilosophie sich darum bemühte, die Auswirkungen des hegelschen Systems zu tilgen und die deutsche romantische Bewegung endgültig ihren Lebensodem aushauchte. Letzteres ist darum von Belang, weil die beiden Philosophiehistoriker sich bemühen, der Romantik den oft eingeklagten und vielversagten Ruf einer wissenschaftlich versierten Strömung in der deutschen Geistesgeschichte zuzugestehen. Darum scheuen sie sich nicht, Ausführungen zu Novalis oder Friedrich von Schlegel zwischen die umfangreicheren und notwendig komplexer ausfallenden Abhandlungen zu Schelling und Konsorten zu positionieren. Im Grunde ein Versuch der Gerechtigkeit gegenüber der Romantik, die bis heute auf ihren „belletristischen“ Beitrag zur deutschen Kultur reduziert wird, zum Gespinst einiger Irrationalisten erklärt und despektierlich aus der Philosophie verbannt wurde. Ein Prozess, der bereits mit Hegels Zugeständnis nur einer Handvoll polemischer Sätze über Novalis in der Niederschrift seiner Vorlesungen zur Philosophiegeschichte in Gang gebracht worden war und erst in den letzten Jahrzehnten durch die Bemühungen von Werner Hamacher, Hans Meyer, und anderen gezügelt wurde. Dass Käte Hamburgers berühmter Aufsatz Novalis und die Mathematik hier keine Erwähnung findet, muss als Versäumnis gewertet werden. Denn gerade die Vermessung solcher Randgebiete der großen Systemgebäude – ausgeklammerte Romantik und die vom beginnenden 19. Jahrhundert argwöhnisch beäugte, quantifizierende Wissenschaft – erlaubt es vielleicht noch einiges neues über den Idealismus und seine zeitgenössische Wirkung herauszufinden.
Nachzeichnung der begrifflichen Genese des philosophischen Feldes des 19. Jahrhunderts
Trotz solcher vielleicht mit allzu großer Spitzfindigkeit heraufbeschworener Mängel, gelingt es den Autoren immer wieder von heutigen Lesern einfach nur hingenommene Details in den Fokus der Aufmerksamkeit zu ziehen und sie so lange neu zu beleuchten, bis sie in einem ganz anderen Licht wahrgenommen werden. Dabei erschöpfen sich ihre Erläuterungen nicht in der Klärung von Fachfragen, sie verstehen es in der Zeit zurückzugehen und sich – dank den historisierenden Blick abbauender Hermeneutik – in die Kontexte und Wissenschaftsstände der damaligen Zeit hineinzubegeben. Das ist einer denkerischen Epoche, die wie keine vor ihr die Geschichte für sich in Beschlag genommen hat, nur angemessen. So werden die philosophischen Entscheidungen in diesem historischen Kontinuum plausibel gemacht, indem dessen Anforderungen an die Schreibenden gegenüber ihrem Anspruch vor Augen treten.
Beispielhaft hierfür steht etwa die einfach hingenommene Kategorie des Geistes aus der hegelschen Philosophie. Philosophiestudenten der letzten 200 Jahre, welchen die Phänomenologie des Geistes als Standardwerk angedacht wurde, mag er selbstverständlich erscheinen. Doch der Terminus Geist, darauf weisen Jaeschke und Arndt hin, war zu Hegels Zeit keineswegs ein feststehender Operationsbegriff der Philosophie. Erst Hegel führte ihn in die Philosophie ein, als nächsthöhere Stufe, die das Selbstbewusstsein („die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst“) zu erklimmen hatte. Womit der Philosoph einen Unterschied zu den Ich-Begriffen in den Philosophien von Schelling, Fichte und Kant markierte und den Terminus gleichzeitig säkularisierte. Er rührte ursprünglich von dem religiös konnotierten spiritus her. Hegel bediente sich maßgeblich der Differenzierung zwischen profanem und sakralem Sprachgebrauch, welche die Übersetzung ins Deutsche hier erlaubte, um das Fachwort vom „geistlichen“ zum „geistigen“ Begriff, also semantisch in Richtung des weltlichen Pols hin zu verschieben. Entlehnt ist er damit – wie die triadische Struktur der Dialektik daran angelehnt – aus dem christlichen Schema der Trinität von Vater, Sohn und heiligem Geist. Womit in der Integration des Geists in das philosophische Gebäude zugleich der von der hegelschen Geschichtsphilosophie verkündeten Aufhebung der Religion in die Wissenschaft, also Philosophie, wie sie historisch beim Übergang vom Mittelalter in die Moderne sich vollzog, Rechnung getragen wird.
Ein Kompendium für Fachkundige und interessierte Laien
Freilich: viel Material, das die Studie anhäuft, mag auch vorher in der ein oder anderen Weise schon zugänglich gewesen sein – dank der umfangreichen Beschäftigung mit dem Deutschen Idealismus von philosophiegeschichtlicher, historischer, aber auch analytischer Seite aus. Der Verdienst solcher großangelegten Bücher – und gerade Walter Jaeschke hat hier nicht sein erstes geschrieben – liegt jedoch darin, dass sie die in Fachpublikationen versprengten und mit Detailfragen befassten Forschungen zu einem Gegenstand zusammengefasst und überschaubar aufbereiten und mit neuen Deutungsoptionen versehen. Die interessierte und fachgebildeten Leserschaft bekommt so einen Leitfaden, der sie aus dem Labyrinth der unüberschaubar gewordenen Sekundärliteratur heraus und wieder an die Haupttexte heranführt. Der in der Philosophie Bewanderte steht solchen Büchern bei aller Anregung der Gedanken, die sie provozieren, letztlich mit einem Gefühl gegenüber: Dankbarkeit.
Walter Jaeschke und Andreas Arndt: Die klassische deutsche Philosophie nach Kant. Systeme der reinen Vernunft und ihre Kritik 1785–1845. München: Beck 2012, 749 Seiten, 78€, ISBN 978-3-406-63046-0
Zum Autor: Florian Scherübl ist Bachelor of Arts in Philosophie und Germanistik und freier Mitarbeiter im Verlagswesen.